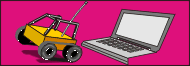Luft
Luft und Auftrieb |
|
Fachwissenschaftlicher Bezug 1
Statischer Auftrieb heißt die der Schwerkraft entgegenwirkende Kraft auf einen in ein Gas oder auch in eine Flüssigkeit gebrachten Körper. Nach dem archimedischen Prinzip "verliert" der Körper dann scheinbar so viel an Gewicht, wie die von ihm verdrängte Flüssigkeits- oder Gasmenge wiegt (archimedisches Prinzip). Ist dieses Gewicht größer als sein eigene, steigt der Körper auf.
Wenn sich ein Körper gegenüber dem umgebenden Medium bewegt und dabei so geformt ist, dass die Strömungsgeschwindigkeit des Mediums an seiner Oberseite größer als an seiner Unterseite ist, entsteht ein dynamischer Auftrieb. Tragflächen von Flugzeugen sind so gebaut.
|
| Luft und Licht |
|
Verschieden dichte Stoffe (Medien), z.B. Luft und Wasser, sind optisch unterschiedlich dicht. Dichte ist das Verhältnis der Masse eines Körpers zu seinem Volumen. Einheit: kg/m3). Somit breiten sich Lichtstrahlen nicht mehr gradlinig aus und Grenzflächen werden sichtbar.
Luftdichteänderungen z.B. bei starker Erhitzung führen zu Flimmern über der Oberfläche und zu Spiegelungen (Fata Morgana).
Die unterschiedlichen Brechungszahlen von Luft (1,0), Wasser (1,3) und Glas (1,6) sind geeignet, Luft in entsprechenden Versuchsanordnungen sichtbar zumachen.
|
| Luft und Schall |
|
Schallwellen und Schallereignisse
Schall sind Schwingungen der Materien, die mit dem Ohr gehört oder mit physikalisch-technischen Geräten nachgewiesen werden können. Als Schallwellen bezeichnet man geringfügige Luftdruck-schwankungen, aber auch Druckschwankungen in Flüssigkeiten oder Festkörpern.
Schallereignisse sind durch drei Eigenschaften definiert: Tonhöhe (Frequenz), Lautstärke (Amplitude) und Klangfarbe (Wellenform). Menschen können maximal Schallwellen im Frequenzbereich von ca. 16 bis 28 000 Hertz wahrnehmen, wobei das Hörvermögen für Töne im oberen Bereich mit fortschreitendem Alter deutlich abnimmt. Frequenzunterschiede und damit verbundene Tonhöhenschwankungen können im Bereich von ca. 400 bis 8 000 Hertz auch bei sehr geringen Abweichungen vernommen werden.
Der für den Menschen nicht mehr hörbare Schall heißt Infraschall (unter 16) bzw. Ultraschall (über 20 000 Hertz). Manche Tiere (z. B. Hunde, Fledermäuse) können auch Ultraschall noch hören.
Man unterscheidet die aus ungefähr sinusförmigen Schwingungen bestehenden Töne, die aus mehreren Tönen zusammengesetzten Klänge und Geräusche. Unter einem Geräusch versteht man ein komplexes Schallereignis, das aus sehr vielen verschiedenen Frequenzen zusammengesetzt ist, die in keiner harmonischen Beziehung zueinander stehen.
Ob ein Schallereignis noch zu vernehmen ist, ist von der Intensität abhängig. Diese fällt im Quadrat des Abstands von Standort und Quelle. Ohne Intensitätsverlust, also in einem "ideal homogenen Medium" erklingt eine Schallquelle in einem Abstand von einem Meter neunmal intensiver als in drei Meter Entfernung.
Maßeinheit für die Lautstärke ist das Dezibel (dB). Der Schalldruckpegel wird dabei als logarithmische Größe erfasst, weil der Schalldruck am menschlichen Ohr über mehrere Zehnerpotenzen gehen kann. So empfindet das menschliche Ohr eine Zunahme von etwa fünf Dezibel bereits als doppelt so laut. In einer ruhigen Wohngegend zeigt ein Schallpegelmessgerät etwa 38 Dezibel an. Eine gewöhnliche Unterhaltung erhöht die Schallpegelanzeige auf circa 70 Dezibel. Die Schallstärke einer Sirene kann bis zu 150 Dezibel erreichen, die eines Flugzeuges etwa 120 Dezibel.
Schallnutzung
Schallschutz
Wegen der zunehmenden Lärmbelästigung finden Maßnahmen des Schallschutzes immer größere Beachtung. Lärm ist ein negativ empfundenes Geräusch, das zu einer Lärm-Verärgerungs-Reaktion führt, die von der Dauer der Einwirkung und dem Lärmstärkepegel abhängt. Lärmbelästigung kann zu psychischen Belastungen und auch zu somatischen Erkrankungen führen. Schlafstörungen zählen zu den häufigsten Folgeerscheinungen.
Immissionsschutzbestimmungen zielen dabei nicht nur auf eine Verringerung der Schalintensität, sondern regeln auch den Abstand von Lärmquellen und z.B. Wohngebieten. Durch bauliche und technische Maßnahmen müssen getroffen werden, um verschärfte Lärm-schutzbestimmungen einzuhalten. Hierzu gehören beispielsweise Lärm-schutzwände, eingekapselte Motoren, Doppelfenster usw. Allerdings führt Alltagslärm aus der Nachbarschaft häufiger als der von Verkehr und Industrie zu gerichtlichen Auseinandersetzungen. Kinder, Hunde und Stereoanlagen sind häufig Anlass zu Klagen, wobei weniger die Schallintensität als Fragen des nachbarschaftlichen Zusammen-lebens der Auslöser sind.
Die von den jeweiligen Verkehrsmitteln ausgehende Lärmemission wurde durch technische Maßnahmen in den letzten Jahren deutlich gesenkt, allerdings haben die höhere Anzahl der Fahrzeuge, mehr Flugbewegungen, eine erhöhte Freizeitmobilität und andere Faktoren diese Verbesserungen mehr als wettgemacht.
Industrielärm, der in oder am Rande von Gewerbegebieten entsteht, wirkt sich doppelt verhängnisvoll aus: Beschäftigte wie dort Wohnende sind Leidtragende der Lärmemissionen, hinzu kommen Verkehrslärm durch Zulieferungen, diese teilweise aus logistischen Gründen rund um die Uhr.
Als besonders schädlich zeigen sich zunehmend Hörgewohnheiten insbesondere bei Jugendlichen. Walkman und andere Geräte mit Ohrstöpseln erlauben einen für die Umwelt erträglichen, aber ggf. für den Hörer um so verhängnisvolleren Musikkonsum. Auch wegen des hohen Schallpegels in Diskotheken und bei Musikveranstaltungen werden für die Zukunft bei zahlreichen Jugendlichen massive Hörschädigungen erwartet.
Schallausbreitung in der Erdatmosphäre
In der Atmosphäre kommt es zu Ungleichmäßigkeiten von Temperatur, Druck oder Feuchtigkeit und damit zur Absorption von Schallwellen, daher gilt die Formel vom Abstandsquadrat nur annähernd.
Die Schallgeschwindigkeit beträgt unter Normalbedingungen ca. 330 Meter pro Sekunde und steigt etwa bei zunehmender Temperatur (z.B. bei 20 °C liegt sie bei 344 m/sec). Auch ist die Schallgeschwindigkeit in feuchter Luft größer als in trockener Luft. Bei gleichmäßiger Dichte breitet sich der Schall geradlinig aus. Schallwellen können durch Luftdruckunterschiede und Luftbewegungen gebrochen oder abgelenkt werden, was beim Rufen mit und gegen den Wind wahrnehmbar ist.
Schallwellen können reflektiert werden. In der Natur ist dies als Echo beobachtbar. Bei einem Megaphon wird die Reflexion an den Trichterwänden ausgenutzt, um Schallwellen zu bündeln. Ein Hörrohr ist eine Art umgedrehtes Megaphon, das die Schallwellen auf das Ohr hin reflektiert.
Schallausbreitung im festen und flüssigen Körpern
In Flüssigkeiten und Festkörpern ist die Schallgeschwindigkeit aufgrund der höheren Dichte höher als in Gasen. Durch die höhere Dichte ist etwa Geräusche unter Wasser besser wahrnehmbar als an Land, auch überträgt Stahl (z.B. Eisenbahnschiene) den Schall um ein Vielfaches schneller als die Luft. |