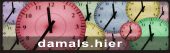Die Pilgergruppe war schon ziemlich erschöpft, das Fortkommen auf dem engen Pfad den steilen Hang hinauf kräfteraubend und gefährlich. Schon seit Stunden regnete es unaufhörlich und unten in der Tiefe rauschte der Eisack bedrohlich wie in einem Höllenschlund. Bald würde es dunkel werden und sie hatten seit Tagesanbruch erst rund 20 Kilometer geschafft. Auf der Anhöhe war das Hospiz zu erkennen, wo ein Strohbett und eine warme Suppe auf sie warteten. Gerade gestern hatte sich ein Felsbrocken gelöst und ein Pferd mit in die Tiefe gerissen. Leise beteten die vor Kälte zitternden Pilger vor sich hin, flehten den hl. Jakobus, den Pilgerpatron, um Hilfe an, ängstlich den Blick auf das Hospiz gerichtet. Bald hatten sie es geschafft.
Die Alpen stellen ein natürliches Hindernis für den Verkehr zwischen Mittel- und Südeuropa dar. Die großen Täler Inntal, Wipptal, Eisacktal und Etschtal bieten die Möglichkeit, zum Brennerpass (1371 m) und zum Reschenpass (1510 m) zu gelangen.
Ursprünglich gab es nur zu Fuß begehbare Pfade, dann schmale Pfade für Saumpferde (Lastpferde), später befahrbare Wege für Karren, Wagen und Kutschen. Fußwege führten sehr oft in der Höhe und nicht im Tal.
Mit der Ausdehnung des römischen Reiches wurde auch die Erschließung durch Straßen vorangetrieben, auf denen Handelsgüter und vor allem Soldaten rasch von einem Ort zum anderen bewegt werden konnten.

Hl. Jakobus der Ältere (Foto A. Prock)
Die Herrscher, die zu ihrer Kaiserkrönung durch den Papst nach Rom zogen, wählten vorwiegend den Weg durch Tirol. Von 754 (Pippin) bis 1452 (Kaiser Friedrich III.) sind 74 Italienzüge belegt, davon 66 über den Brenner. Deshalb erhielt diese Route auch die Bezeichnung „Kaiserstraße“.
Im frühen Mittelalter dienten die vorhandenen Straßen grundsätzlich als Heer-, Boten- und Pilgerverbindungen. Vor allem die Kreuzzüge ließen den Handel mit den orientalischen Märkten ansteigen, wobei die Hafenstadt Venedig ein wichtiger Umschlagplatz wurde. So nahm ab dem 12. Jahrhundert der Handelsverkehr stark zu und die mittelalterlichen Straßen folgten großteils dem Verlauf der Römerstraßen.
Neben Kaufleuten, Handelsreisenden, Adeligen und Gesandten zogen vor allem Gaukler, Gelehrte, Studenten, Handwerker und Künstler sowie große Pilgerscharen durch Tirol. Für ihre Versorgung entstanden entlang der Hauptrouten Hospize, Spitäler sowie Gasthäuser.
Neben den zwei Hauptwegen über Brenner- und Reschenpass in Richtung Süd-Nord und umgekehrt, gewann nach der Übernahme Tirols durch die Habsburger im Jahre 1363 die Ost-West-Verbindung an Bedeutung. Damals wurden die Strecken durch das Pustertal nach Kärnten und über den Arlbergpass nach Vorderösterreich verbessert.

auf dem Inn – Abb. in Neubeuern (Foto A. Prock)
Auch die Flüsse Inn und Etsch waren wichtige Verkehrswege. Westliches Ende der Innschifffahrt war Hall. Die Etsch war ab Branzoll schiffbar. Flussaufwärts wurden die Schiffe von Pferden gezogen, die entlang des Ufers gingen. Der Bau der Eisenbahn in den Jahren um 1860 bedeutete das Ende der Flussschiffahrt.
Kaiser Maximilian richtete die ersten Postverbindungen ein, die von Innsbruck aus in die Niederlande und über den Reschenpass, das Wormser Joch und das Veltlin nach Mailand führten. Wichtig war für ihn eine möglichst schnelle Nachrichtenübermittlung. Personenverkehr wurde erst zu Beginn des 18. Jahrhunderts eingeführt.
In der Neuzeit wirkten sich verschiedene politische Ereignisse – Reformation, Bauernkriege, und Dreißigjähriger Krieg – meist negativ auf den Verkehr in Tirol aus. Auch das veraltete Zoll- und Mautwesen schadete Tirol.
Vor allem Maria Theresia und ihr Sohn Kaiser Josef II. setzten sich intensiv für den Bau neuer Straßen ein und konnten dadurch den Transitverkehr ankurbeln. Gerade die Zunahme des Personenverkehrs bei der Post und die damit verbundenen größeren Postkutschen bedingten breitere und bessere Straßen.

Europabrücke (Foto A. Prock)
Im 18. Jahrhundert traf man auf immer mehr Bildungsreisende. Gleichzeitig wurde das Interesse an der unberührten Natur der Alpen geweckt. Langsam begann der Tourismus sich zu entwickeln, wobei vor allem die Engländer großes Interesse an der Bergwelt zeigten.
Im 19. Jahrhundert entstanden überall in der Monarchie neue Straßen, der Zugang zu den Adriahäfen Triest und Venedig wurde erleichtert. Erst mit dem Bau der Eisenbahn in den Jahren um 1860 wurde der Massentransport von Waren und Menschen möglich – eine neue Zeit brach an. In Tirol entstanden die Eisenbahnen durch das Inntal, die Arlbergbahn, die Brennerbahn und die Bahn nach Verona.
Das 20. Jahrhundert gilt als das Jahrhundert des Automobils. Wichtig wurde dabei der Faktor Zeit – Personen und Güter sollten möglichst schnell von einem Ort zum anderen transportiert werden. Neue Straßen mit Tunnels, Gallerien, Brücken, Übergängen und Unterführungen wurden gebaut. Zentrale Ausbaustrecke war jene durch das Unterinntal und über den Brennerpass.
Höhepunkt war sicherlich der Bau der Autobahnen in den 1960er und 1970er Jahren. Als besondere Glanzleistung dabei ist die Europabrücke zu sehen. In den letzten Jahrzehnten stieg der Gütertransport mit dem LKW stark an, aber auch der Urlaubsverkehr mit dem PKW.
Die Brennerstrecke bleibt die einzige Schnellverbindung vom Norden in den Süden, weitere geplante Großprojekte wurden bisher nicht verwirklicht.
Literatur:
Loose Rainer (Hg.): Von der Via Claudia Augusta zum Oberen Weg, Schlern-Schriften 334, Innsbruck 2006.
Strolz Bernhard: Die Salzstraße nach Westen – Ein Kulturführer von Hall in Tirol übers Außerfern durchs Allgäu zum Bodensee, Innsbruck-Wien 2004.
Andergassen Leo u. a.: Pässe, Übergänge, Hospize – Südtirol am Schnittpunkt der Alpentransversalen in Geschichte und Gegenwart, Lana 1999.
|