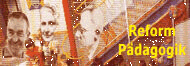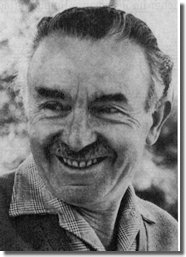|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
Jenaplan-Pädagogik
Allen voran ist in
diesem Zusammenhang Peter Petersens Jenaplan und sein ausdrücklich als
"Ausgangsform" bezeichnetes pädagogisches Konzept zu nennen. Wir dürfen
diesen Begriff durchaus wörtlich nehmen und von etwas ausgehen, um die
uns entsprechende Form der Schule und der "pädagogischen Situation" in
dieser zu entwickeln.
Ausgehen werden wir
von den vier Bildungsgrundformen,
- der Feier,
- dem Gespräch,
- der Arbeit und
- dem Spiel.
Ausgehen
werden wir weiters von einer Rhythmisierung dieser vier Formen im schulischen
Tagesablauf der Kinder statt von der Unmöglichkeit des Lernens nach einem
"Fetzenstundenplan", von einer altersheterogenen Gruppierung der
Kinder in verschiedenen Gruppen statt Jahrgangsklassen, von einem Lernen
und Leben in einer Schulwohnstube und von einem grundsätzlichen Bewusstsein,
dass wir keine Zensuren mehr vergeben, aber die Entwicklung des Kindes
beobachten und beschreiben. Gemeint ist die Entwicklung des Kindes
in der von uns vorbereiteten "Pädagogischen Situation", die für
das Lernen des Kindes nicht nur den Lebensbezug bereithält, sondern die
"innere Begegnung" des Kindes mit dem zu Lernenden anstrebt.
Davon ausgehend wird
jede Jenaplanschule ihre eigenständige Entwicklung nehmen können. Ausgehend
von der Ausgangsform wird sie den Lebens- und Lernbedürfnissen der Menschen,
die sie besuchen und die sie entwickeln, entsprechen, und sie kann - wie
europaweit gezeigt wird - damit auch den staatlichen und europäischen
Anforderungen sowie dem Lehrplan entsprechen.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Montessori-Pädagogik
Im Vergleich zur Pädagogik
Peter Petersens ist Maria Montessoris Konzept primär auf die Entwicklung
des Kindes bezogen und expressis verbis ein sogenanntes Entwicklungskonzept.
Als didaktisch weitgehend
durchkonzipiertes System und in den Grundsätzen der Montessori-Pädagogik
bietet es eindeutige Anregungen zur Gestaltung einer pädagogischen Institution:
- in der Gestaltung
der "Vorbereiteten Umgebung",
- der Organisation
nach altersheterogenen Gruppen,
- der Idee des Kinderhauses
-
statt der Trennung
von pädagogisch eigentlich zusammengehörigen Institutionen (wie Kindergarten
und Schule).
Montessori-Pädagogik
ist einer Schulentwicklung und nicht nur einer Gestaltung dienlich:
Sie ist intentional eine Pädagogik der Selbstbestimmung (und auch
der Ich-Findung). Eine Pädagogik der Selbstbestimmung (Vgl. auch: Eichelberger,
H., Handbuch zur Montessori-Didaktik, Innsbruck 1997.) wird in ihrer Realisierung
auch die Selbstbestimmung aller Personen einer pädagogischen Institution
anstreben, will sie ihre Glaubwürdigkeit erhalten. In Konsequenz dieses
Gedankens wird nicht nur die Integration der Montessori-Pädagogik in ein
bestehendes Schulsystem angestrebt, sondern die Montessori-Pädagogik als
für eine Schulentwicklung geeignetes System angesehen und selbst als entwicklungsfähige
pädagogische Konzeption betrachtet.
Dabei
stellt sich die Frage, ob die Montessori-Pädagogik auch eine Ausgangsform
sein oder als solche aufgefasst werden kann. Die Diskussion, die diese
Frage zu beantworten versucht, kann sowohl für die Entwicklung der Schule
als auch für die Entwicklung der Reformpädagogik sehr fruchtbar sein.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Daltonplan-Pädagogik
Helen Parkhursts Konzept
des Daltonplans ist aus der Entwicklung eines neuen Schulkonzeptes entstanden
- das Prinzip der Entwicklung ist dieser Pädagogik immanent.
Helen Parkhurst betont,
dass sie den Daltonplan nicht als System bezeichnet haben möchte, sondern
vielmehr als "Way of Life". Und dieser orientiert sich an Prinzipien,
die der hier angeregten Schulentwicklung eine eindeutige Orientierung
und Richtung verleihen:
- das Prinzip
der Freiheit,
- das Prinzip
der Kooperation und - später hinzugefügt -
- das Prinzip
vom Verhältnis des Aufwandes zur Erreichung des Zieles oder Budgeting
Time.
An individuellen Lernaufgaben
soll der Schüler in selbständiger Arbeit, - alleine oder in Zusammenarbeit
- lernen und wachsen und für seinen Entwicklungsprozess die Verantwortung
tragen können.
Die pädagogischen
Prinzipien des Daltonplanes sind Grundprinzipien für die Entwicklung
einer Schule bzw. auch für die Entwicklung des Schul- und Bildungswesens.
Schulentwicklung nach diesen Prinzipien schließt die Prinzipien
der Freiheit, der Kooperation und des Verhältnisses des Aufwandes zum
Ziel auch für die Arbeit der
- Lehrerinnen und
Lehrer,
- der Eltern und
- der Schüler ein.
Das würde auch die
Freiheit der Schulgestaltung, der Wahl eines pädagogischen Konzeptes,
die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen und alle weiteren Möglichkeiten
einschließen.
Weiters ist der Daltonplan
auch selbst frei für Veränderung, wie die Einführung bzw. die Entwicklung
des Subdaltonplanes für die Grundschule in Holland beweist.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Freinet-Pädagogik
Die Freinet-Pädagogik
war und ist nicht auf die schulische Arbeit alleine beschränkt. Sie war
und ist eine Pädagogik mit dem Anspruch der Veränderung der Gesellschaft.
Nicht nur die Gestaltung der Schule ist die Aufgabe der Lehrer, Eltern
und Kinder.
Gerade mit der Aufgabe der Schulgestaltung und Schulentwicklung
wollte Célestin Freinet in seinen Kindern das Bewusstsein schaffen, dass
auch die Gesellschaft nach den Bedürfnissen des Kindes bzw. der Betroffenen
veränderbar ist. Er hat den Kindern das Wort gegeben, damit sie lernen,
sich zu artikulieren, damit sie lernen können, in einer Demokratie zu
leben - verantwortlich für sich selbst und für andere Menschen und doch
selbstbestimmend innerhalb eines demokratisch strukturierten sozialen
Gefüges zu sein. Wo sonst sollen Kinder Demokratie lernen,
wenn nicht in der Schule? Und wir dürfen und müssen nicht nur den Kindern
das Wort zur Gestaltung und Entwicklung ihrer Schule geben, sondern auch
den Lehrerinnen und Lehrern und den Eltern.
|
|
|
|
|
|
|
| |
Reformpädagogen
im Überblick
Ich stelle die bedeutendsten
Reformpädagoginnen und Pädagogen in einer geschichtlich-tabellarischen
Form dar.
Reformpädagogik
und Reformpädagogen
Die Tabelle ermöglicht
eine Übersicht über die Zeit der Reformpädagogik und deren Vertreter.
Diese sind zeitlich nach dem Erscheinen, des von ihnen kreierten pädagogischen
Konzeptes geordnet. Die Idee zu dieser Tabelle verdanke ich meinem Freund
Wolf Dieter Kohlberg, Lehrerbildner an der Universität Osnabrück.
|
|
|
|
|