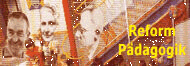|
|
|
|
|
|
|
Berichtszeugnis /
Verbalbeurteilung /
Lern(Entwicklungs)bericht)
Eltern
und Leistungsbeurteilung
Zeugnistypen
bei der
Verbalbeurteilung
(Benner/Ramseger)

|
 |
Es gibt erstaunlich
wenig Evaluationsstudien zum Verbalzeugnis, trotz des Interesses und der
hohen Erwartungen, welche diese Zeugnisreform in Deutschland ausgelöst
hat. Für Schmidt haben sich die hohen Erwartungen, die mit der Reform
verknüpft waren, nicht erfüllt, und er meint, dass bei einer Veränderung
der Bewertungspraxis das Hauptgewicht auf intensive Elterngespräche gelegt
werden sollte.
Scherer u.a. (1985)
kommen in ihrer repräsentativen Untersuchung von Lernberichten zu dem
ernüchternden Schluss:
"Das wichtigste
Ziel der Reform, die individuelle, an der Entwicklung des einzelnen
Schülers orientierte Beschreibung und Beurteilung seines Sozial- und
Arbeitsverhaltens findet sich in den untersuchten Zeugnissen kaum
verwirklicht. Nicht die Persönlichkeit des Schülers, sondern die des
Lehrers bestimmt die Auswahl und die Kombination der Inhaltskategorien,
die angesprochen werden"
(Schmidt u.a., 1985, nach: Jürgens, 1999). |
Schmidt (1981) kommt
aufgrund seiner Daten zum Schluss, dass"das
Zeugnisschreiben für die meisten Lehrer eine mühsame und schwierige Pflichtaufgabe
ist, der man sich notgedrungen und ein bisschen mürrisch unterzieht, die
aber keine Freude macht." Dies gilt insbesondere für die Verfassung von
Lernberichten. Viele Lehrer hatten erhebliche Vorbehalte gegenüber der
Verbalzensur, und etwa zwei Drittel wünschten eine teilweise Rückkehr
zum Notenzeugnis. Schmidt führt das hauptsächlich auf die großen Unsicherheiten
beim Schreiben der Zeugnisse zurück. Er schlussfolgert:
|
|
| |
|
|
|
| |
|
"Eine Reform
(der Zeugnisform) hat nur dann Aussicht auf Erfolg, wenn bei den Reformträgern
eine innere Betroffenheit gegeben ist und somit eine Einstellungsänderung
vorausgeht, die sich in Übereinstimmung mit den Reformzielen befindet.
(Dabei sind) intensive und qualifizierte Vorbereitungen vor allem
in Form von Fortbildungsmaßnahmen erforderlich"
(zitiert nach: Jürgens, 1999, S. 44). |
Ein weiteres Problem
besteht nach der Untersuchung von Schmidt u.a. darin, dass "der überwiegende
Teil der Zeugnistexte sich nahezu genau mit den offiziellen Formulierungshilfen
im Beispielkatalog deckt... Wenn offenbar LehrerInnen, wenn sie Berichtszeugnisse
schreiben, dazu neigen, ... sich auf eine mehr oder weniger große Anzahl
standardisierter ... Inhaltskategorien zu beschränken ..., dann ist das
ein fragwürdiges ... Vorgehen. (Jürgens, 1999, S. 46)
Elbing/Buschmann
(1985) stellen in ihrer Untersuchung fest, dass zwar bei der Hälfte aller
Zeugnisse Lernschwierigkeiten ausdrücklich angesprochen wurden, dass aber
als Ursache dafür häufig allein das Kind genannt wurde. Sie kommen aber
zu einem positiven Fazit, was den Einfluss der Einführung von Verbalzeugnissen
auf den Lehrer betrifft:
"Wortzeugnisse halten
... den Lehrer dazu an, sich auf seine pädagogische Aufgabe - als vielseitige
und individualisierende Förderung aller Schüler - zu besinnen" (S. 34).
Und Jürgens kommentiert:
" Schon allein
die Pflicht, schriftlich ein Verhalten in Form eines Berichts beurteilen
zu sollen, führt dazu, sich genauere und weitgefasstere Gedanken zu
einem Kind zu machen"
(Jürgens, 1999, S. 48). |
|
|
| |
|
|
|
| |
|
Auch in ihrer Untersuchung
stellt Ulbricht (1993) fest, dass Störungen im Lern- und Arbeitsverhalten
einseitig dem Schüler angelastet werden. In den von ihr analysierten Zeugnissen
waren Aussagen zum Leistungsstand eindeutig dominant: "Damit ist auch
dem Verbalzeugnis die Funktion geblieben, primär über die erzielten Leistungen
zu informieren und ev. die Grundlage für administrative Entscheidungen
zu liefern" (S. 200). Weiterhin bemängelt sie, dass Hinweise zum Weiterlernen
und zur individuellen Förderung in den Zeugnissen fehlen. Sie schlussfolgert:
"Die Verbalbeurteilung per se bedeutet keine Garantie für eine kindgemäße
(Grund-)Schule" (S. 212).
In Haenischs Untersuchung
(1996) weisen die LehrerInnen auf die Formulierungsprobleme hin, die sich
beim Zeugnisschreiben ergeben und die darin bestehen, Wiederholungen und
floskelhafte Ausdrücke möglichst zu vermeiden. Auch beklagen viele den
erheblichen Zeitaufwand für das Schreiben der Berichte und plädieren deshalb
dafür, die Halbjahreszeugnisse durch Elterngespräche zu ersetzen. Dagegen
heben sie aber auch positiv hervor, dass sich die SchülerInnen durch die
Lernberichte verstärkt mit ihrer individuellen Lernentwicklung beschäftigen
und stärker in die Verantwortung für ihr Lernen einbezogen werden können.
Das führt auch dazu, dass sie ihre Kenntnisse und Kompetenzen realistischer
einschätzen lernen, dass sie stärker um der Sache willen lernen und dass
sie mehr Toleranz und Anerkennung für die je individuellen Leistungen
der anderen Kinder entwickeln. Was die Mehrbelastung durch das Zeugnisschreiben
betrifft, so wird sie letztlich von den meisten als lohnend empfunden,
weil sie durch diese Art der Schülerbeurteilung einen deutlichen Kompetenzzuwachs
erleben und zum Teil ein "neues Unterrichtsverständnis" entwickeln. Auch
heben manche die Belebung des pädagogischen Gesprächs und der Zusammenarbeit
mit den KollegInnen hervor.
|
|
| |
|
|
|
| |
|
Im Anschluss an den
Schulversuch zeichnet Haenisch ein überwiegend positives Bild: Durch den
Schulversuch wurden "eingefahrene und blockierte didaktische Denkmuster
aufgebrochen", und auch die sozialen Beziehungsformen verbesserten sich.
"Auf dieser Basis entwickeln sich offensichtlich dann neue Qualitäten
des Lernens der SchülerInnen, der Gestaltung des Unterrichts und schließlich
der Entwicklung der einzelnen Schule... Die Verbalzeugnisse führten dazu,
dass die LehrerInnen ihren Unterricht stärker von den SchülerInnen aus
denken" (S. 16).
So zeigt sich, dass
"eine Änderung
der Beurteilungsform Einfluss auf das gesamte schulische Feld und
auf das Verhalten der davon Betroffenen nehmen kann. Verzicht auf
Zensuren zu Gunsten von Textzeugnissen ist eben mehr als der bloße
Wechsel eines Verfahrens... Mit der Änderung der Beurteilungsform
müsste eine Änderung des Unterrichts und der persönlichen Einstellung
... wenn nicht sofort so doch allmählich stattfinden"
(Jürgens, 1999,, S. 52). |
Schaub (1993) beschreibt
die Wechselwirkung zwischen Bewertung und Unterricht aus der Gegenperspektive:
| "Je stärker die
Lehrerin Schülerzentrierung zu einem zentralen didaktischen Prinzip
macht, umso zwingender wird für sie ein Wechsel von der Notengebung
zur zensurenfreien Beurteilung" (zitiert nach Jürgens, 1999, S.
52). |
Dass sich die Einstellung
der LehrerInnen zum Verbalzeugnis verändern kann, hat Jürgens in einer
eigenen Untersuchung (1997) für Nordrhein-Westfalen gezeigt. Gegenüber
früheren Untersuchungen lag die Zahl der LehrerInnen, die mit der Einführung
von Verbalzeugnissen zufrieden waren, sehr viel höher (94 % !). 43 % sprachen
sich für eine Ausweitung der Reform auf die dritte Klasse und 10 % sogar
für eine zensurenfreie Sekundarstufe I aus.
|
|
|
|
|