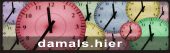Zugegeben, als Schüler hatten wir auch manchmal Mordgelüste – aber im Gegensatz zu den Schülern des Hl. Kassian bekamen wir keinen offiziellen Auftrag, sie auszuleben. Sie sollen ihn mit ihren Schreibgriffeln totgestochen haben, berichtet die Legende.
Die Anfänge des Christentums im Gesamttiroler Raum reichen bis in die Zeit der Römer zurück.

St. Georgenberg ©Foto A. Prock
Im 4./5. Jahrhundert entstand auf dem steilen Felsen von Säben über der heutigen Stadt Klausen im Eisacktal ein religiöses Zentrum. Mit Säben verbunden sind die Namen verschiedener Bischöfe: hl. Kassian, hl. Ingenuin und hl. Albuin sowie Materninus.
Die Anfänge der Kirche von Trient sind in der Mitte des 4. Jahrhunderts zu sehen. Der hl. Vigilius, gestorben 400, wird schon früh als Diözesanpatron verehrt. Der Hochaltar des Dom zu Trient erhebt sich an jener Stelle, wo sich sein Grab befand. Vigil ist heute auch der zweite Bistumspatron der Diözese Bozen-Brixen.
Wichtig für die Christianisierung des Landes war auch die Errichtung von Klöstern: Scharnitz (763), Innichen (769), Müstair im Münstertal (kurz vor 800), St. Georgenberg bei Stans im Unterinntal (Ende 10. Jh.).
Das Land gehörte grundsätzlich dem König bzw. dem Kaiser. Im 11. Jahrhundert vergaben die deutschen Könige bzw. Kaiser das „Land im Gebirge“, wie Tirol damals hieß, als Lehen an die Bischöfe von Brixen und Trient. Diese verliehen es zur Verwaltung weiter an Grafenfamilien, die auch als Schutzherren dienten. Die wichtigsten waren die Grafen von Eppan, Andechs und Tirol. Diese Grafenfamilien rissen das Land an sich.

Neustift bei Brixen ©Foto A. Prock
Einer der bekanntesten Bischöfe war im 12. Jahrhundert Hartmann, der Stift Neustift bei Brixen gründete und unter dem eine Blütezeit des Bistums begann.
In die Geschichte eingegangen ist besonders der Konflikt zwischen dem Brixner Bischof Nikolaus Cusanus und dem Tiroler Landesfürsten Erzherzog Sigmund dem Münzreichen im 15. Jahrhundert. Cusanus studierte Urkunden aus dem 11. Jahrhundert und fand heraus, dass Tirol eigentlich den Bischöfen von Brixen und Trient gehörte und nicht den Landesfürsten. Er wollte das Land zurückhaben, was Krieg mit Sigmund bedeutete. Der Streit wurde erst durch den Tod des Bischofs beendet.
Das religiöse Leben der mittelalterlichen Menschen war besonders durch Stiftungen, Heiligenverehrung, Reliquienkult, Wallfahrtswesen und Bruderschaften bestimmt.
Gegen die Mitte des 15. Jahrhunderts traten in der katholischen Kirche arge Missstände auf. Um das sittliche Leben der Bevölkerung, aber auch der Geistlichen war es schlecht bestellt. Aberglaube, Zauberei und mangelhafte Kirchendisziplin nahmen stark zu. Mit Geld konnte man sich von den Sünden loskaufen. Der deutsche Mönch Martin Luther leitete die Reformation ein. Die Bauern, die vom Adel unterdrückt wurden, sahen in ihm eine Hoffnung und begannen Aufstände vorzubereiten. Einer ihrer wichtigsten Anführer war Michael Gaismair.

Säben – Brunnen mit Heiligen ©Foto A. Prock
Eine weitere Gefahr für das Land bestand in der Täuferbewegung, die vom Landesfürsten verboten wurde.
Gegen diese neuen Bewegungen und die Unruhe im religiösen Leben des 16. Jahrhunderts musste die katholische Kirche etwas unternehmen – sie berief das berühmte Konzil von Trient ein.
Literatur:
Gelmi Josef: Geschichte der Kirche in Tirol, Innsbruck 2001.
Gelmi Josef: Die Heiligen und Seligen Tirols, Kehl am Rhein 2004.
Gelmi Josef: Geschichte der Diözesen Bozen-Brixen und Innsbruck, Von den Anfängen bis zum Jahre 1000, Kehl am Rhein 1994.
Gelmi Josef: Geschichte der Diözesen Bozen-Brixen und Innsbruck, Das Mittelalter von 1000 bis 1500, Kehl am Rhein 1995.
Gelmi Josef: Geschichte der Diözesen Bozen-Brixen und Innsbruck, Die Neuzeit von 1500 bis 1873, Kehl am Rhein 1996.
Gelmi Josef: Geschichte der Diözesen Bozen-Brixen und Innsbruck, Die Neueste Zeit von 1803 bis 1919, Kehl am Rhein 1997.
Gelmi Josef: Geschichte der Diözesen Bozen-Brixen und Innsbruck, Zeitgeschichte von 1919 bis heute, Kehl am Rhein, 1998.
Von Schlachta, Astrid u. a. (Hg.): Verbrannte Erde – Erinnerungsorte der Täufer in Tirol, Innsbruck 2007.
Weger Siegfried und Hölzl Reinhard: Geheimnisvolles Tirol, Innsbruck 2007.
|