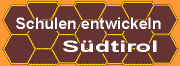
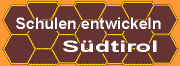 |
Formular | |||||||
| blikk schulentwicklung | ||||||||
| Schulprogramm |
||||||||
| Schwerpunkte und neue Dimensionen des Lernens | ||||
| Ausgehend vom Leitbild kristallisierten sich folgende Schwerpunkte und neue Dimensionen des Lernens für die künftige Arbeit in Schule und Unterricht heraus. Die angeführten Schwerpunkte und neuen Dimensionen des Lernens wurden im Lehrerkollegium diskutiert und in der folgenden Form verabschiedet. Sie stellen das notwendige Bindeglied zwischen dem Leitbild und den Unterrichtsprogrammen der einzelnen Fächer dar und finden sich deshalb auch in der Randspalte der Unterrichtsprogramme wieder. | ||||
|
Sprache und Kommunikation |
Jedes Lernen erfolgt über Sprache, jeder Lehrer / jede Lehrerin ist somit auch Sprachlehrer/in, und zwar als Sprechervorbild, als Vermittler/in der jeweiligen Fachsprache und auch als Übersetzer/in der Fachsprache in die Alltagssprache. Diese "Übersetzung" ist ein wesentlicher Aspekt des Lernens und des Aneignens von Fachwissen und sollte auch von den Schülern geleistet werden. In jedem Fach gibt es viele Möglichkeiten, Sprachbewusstsein zu erzeugen und die Sprachmöglichkeiten zu erweitern. Dabei ist die Zusammenarbeit zwischen Sprachlehrern und Fachlehrern wichtig und notwendig (z.B. Fachtexte lesen, herstellen, zusammenfassen, vereinfachen etc., Schreiben in Sachfächern, Argumentieren, Präsentieren). Auch der Umgang mit Medien und das Erstellen und Gestalten von Medientexten ist ein für Sprachlehrer/innen und Lehrpersonen naturwissenschaftlicher, landwirtschaftlicher und technischer Fächer gemeinsames Thema und Anliegen. | |||
| Maßnahmen und Zuständigkeiten | ||||
| Landwirtschaft, Natur und Umwelt in ihrer Vielfalt | Dieser thematische Schwerpunkt kennzeichnet unsere Schule. In den verschiedenen schulspezifischen Fächern, in den praktischen Übungen, im Rahmen von Lehrausgängen und Betriebsbesichtigungen, Fachtagen und Projekten werden Schüler/innen im Verlauf des gesamten Curriculums mit diesem Lernbereich befasst. Dieser Schwerpunkt, ausgehend vom fachsystematischen Unterricht, bietet sich als Lerndimension an unserer Schule an und soll dazu beitragen, dass das Lernen in Zusammenhängen geschehen kann. Die naturwissenschaftlichen und produktionstechnischen Aspekte werden dabei durch fächerübergreifendes Arbeiten und durch die bewusste Beleuchtung dieser Themenfelder auch aus der Perspektive allgemeinbildender Fächer (z.B. Sprachfächer, Geschichte, Religion) ergänzt und vertieft. Die Bedeutung eines fachsystematischen Zugangs zu den Inhalten wird dadurch nicht in Frage gestellt. Es eröffnet sich dadurch die Möglichkeit eines tieferen Verständnisses für die vielfältigen Dimensionen von Landwirtschaft, Natur und Umwelt. | |||
| Maßnahmen und Zuständigkeiten | ||||
| Herkunft und Zukunft | Der Blick in die Vergangenheit soll nicht nur auf das Fach Geschichte beschränkt bleiben. Wer entdeckt, wie etwas entstanden ist, bekommt oft einen besseren Zugang dazu. Neues und Altes sowie der Umgang damit kann insbesondere im Bereich der Landwirtschaft als wichtiges Thema begriffen werden. Wer Traditionen als Bestandteil der bäuerlichen Welt begreift, kann sie als Hilfen für die Orientierung erkennen. Die Auseinandersetzung mit der Frage nach dem Woher und der Zielsetzung wissenschaftlich/technischer und wirtschaftlicher Entwicklungen ermöglicht ein tieferes Verständnis. Die Zusammenarbeit mit der Geschichtslehrerin/dem Geschichtslehrer kann Wege öffnen. | |||
| Maßnahmen und Zuständigkeiten | ||||
|
Identität und Beziehung |
Nicht nur in den literarischen Fächern, in Religion und Leibeserziehung ist es möglich, persönlichkeitsbildend zu arbeiten. In allen Fächern gibt es Gelegenheit, die Stärken der Schüler/innen zu entwickeln und sie in der Förderung ihrer Identität und Beziehungsfähigkeit zu unterstützen. Dabei ist die Wahl geeigneter Lern- und Arbeitsformen von besonderer Bedeutung. Die Pflege der sozialen Beziehungen der Schüler/innen untereinander und zwischen Schülern und Lehrern liegt im Interesse aller und ist Anliegen im Unterricht und im gesamten Schulleben. | |||
| Maßnahmen und Zuständigkeiten | ||||
| Methodenvielfalt | Da Eigenständigkeit und Verantwortlichkeit der Lernenden als Voraussetzung für nachhaltiges Lernen ernst genommen werden sollen, müssen auch die Arbeitsformen weiterentwickelt werden. Die traditionellen Formen der Wissensvermittlung (Lehrervortrag, Erarbeiten neuer Inhalte im Lehrer-Schüler-Dialog u.Ä.) werden weiter in bestimmten Kontexten ihre Berechtigung haben. Allerdings entspricht das Überwiegen von Arbeitsformen, die die Schüler/innen einseitig mit einer Überfülle an festgefügten und vorgegebenen Fertigergebnissen der Wissenschaften konfrontieren, nicht mehr dem heutigen Verständnis von Bildung und auch nicht den Erwartungen der Arbeitswelt. Deshalb gilt es, Arbeitsformen einzuüben und verstärkt einzusetzen, die selbstentdeckendes Lernen und Verstehen in den Vordergrund rücken. Solche Arbeitsformen - praktisches Lernen, Lernen an Fallbeispielen, fächerübergreifendes Lernen, Gruppenarbeit, Projektunterricht, exemplarisches Lernen, u.a.m. - sind durchaus erprobt und bieten vor allem auch vielfältige Möglichkeiten sozialen Lernens. Vor allem nehmen sie die zunehmende Reife der Schüler/innen ernst und ermöglichen ihnen aktive Formen und individuell verlaufende Lernprozesse. | |||
| Maßnahmen und Zuständigkeiten | ||||
| Öffnung der Schule |
Die Öffnung der Schule nach außen und die Kooperation mit verschiedenen Partnern sehen wir als unabdingbar für nachhaltiges Lernen und eine tragfähige Bildung. Die bisher an unserer Schule gemachten Erfahrungen in der Kooperation mit außerschulischen Partnern und ganz allgemein in der Öffnung der Schule sind ermutigend und bilden eine gute Ausgangsbasis für weitergehende Schritte. Es gilt nun, die bereits laufenden Aktivitäten zu bündeln und zu systematisieren, neue Initiativen zu ergreifen und sie in die didaktische Arbeit zu integrieren. Öffnung der Schule und Kooperation mit Partnern ist für uns nicht Selbstzweck, sondern dient dazu
|
|||
|
© Pädagogisches Institut der deutschen Sprachgruppe - Bozen - 2000 | |||||